Basic HTML-Version

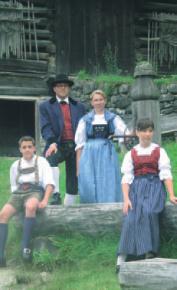


H
err Steiner, die Tracht in Tirol – das
scheint ein weites Feld zu sein. Wie
schafft man es, da auf einheitliche
Aussagen zu kommen und Ordnung hinein-
zubringen?
Reinhold Steiner:
Das ist keine
leichte Aufgabe. In mehreren Gegenden
Tirols haben sich im Laufe der Jahre Dinge
entwickelt, die nicht den historischen Ge-
gebenheiten entsprechen. Da versucht der
Trachtenverband dann mit Aufklärungs-
arbeit und Unterstützungen ein Umdenken
anzuregen. Natürlich können wir keine
Ortsgruppe zu einer Tracht zwingen, es ist
aber schon unser Anliegen, die Tracht zwar
als etwas Dynamisches zu sehen, grob ver-
zerrende Einflüsse aber auf Distanz zu hal-
ten. Den Maßstab für unsere Arbeit geben
uns unsere wissenschaftlichen Beiräte vor,
die wir bei allen Projekten dabeihaben.
Seit wann kann man in Tirol historisch ge-
sehen überhaupt von der Tracht sprechen?
Die Tracht als bäuerliches Gewand un-
terlag einer ständigen Wandlung. Wir
beziehen unsere Beispiele ca. ab dem 13.
Jahrhundert, der Zeit unserer Trachtenpa-
tronin der Hl. Nothburga von Eben. Unifor-
miert wurde die Tracht am markantesten
um 1809, als es im Befreiungskrieg darum
ging, Soldaten als solche zu erkennen. Hun-
dert Jahre später gab es im Zuge dieses Ju-
biläums viele Neugründungen von Kompa-
nien und Vereinen, die die Tracht aber im
nicht eigentlichen Zweck mit Abzeichen
versahen und als Uniform nutzten.
Was bezweckt der Landestrachtenverband
mit seiner Arbeit?
Die über 100 Vereine des Landesverbandes
wollen ganz generell die Leute zumTrachten-
tragen animieren und zwar auch in der werk-
täglichenZeit, nicht nur anFesttagen. Es geht
darum, die Tracht imUnterschied zu Unifor-
men wie sie beispielsweise bei den Schützen
oder der Blasmusik getragen werden, als „un-
serG’wand“wiedermehr insBewusstseinder
Bevölkerungzubringen.Wichtig isthierauch,
dass man das Tragen der Tracht nicht mit
Nostalgie verwechseln soll und, dass das, was
landläufig als trachtige Kleidung bezeichnet
wird, keine Tracht ist – allein schon aus äs-
thetischen Gründen. Wer in Festtagstracht
ins Landestheater geht, ist absolut passend
gekleidet und sticht sogar noch positiv hervor.
Auch soll vermittelt werden, dass, zumindest
was die Frauentracht betrifft, die selbstgefer-
tigteTracht das Ideal darstellt.
Warum gilt das nur für die Frauentracht?
Die Entwicklung ist auf dem Gebiet der
Männertracht quasi zum Erliegen gekom-
men. Die überlieferten Schnitte und Ferti-
gungstechniken sind kompliziert und ver-
langen sehr viel vom Trachtenhersteller.
Diese Arbeit kann eigentlich nur von einem
ausgebildeten Schneider gemacht werden.
Die Frauentracht hat im Vergleich dazu
stetige Modifikationen erlebt und blieb so
immer ein tragbares und im Vergleich eher
leicht herzustellendes Kleidungsstück.
Welche sind die gegenwärtigen Definiti-
onsmerkmale der Tiroler Tracht in ihrer
ursprünglichen Form?
Die wesentlichen Merkmale der Frauen-
tracht sindLeibschnürung, SchürzeundKra-
genausschnitt. BeimMann wird es da schon
etwasschwieriger.Es ist jaeinIrrglaube, dass
früher jeder Tiroler eine lederne Kniebund-
hose besaß. Leder war nur einem gewissen
Stand vorbehalten, viel gebräuchlicher war
die schwarze Langhose. Heute propagieren
wir in Tirol den klassischen Trachtenanzug
in braun oder anthrazitgrau. Die grundlegen-
den Merkmale sind hier das Fehlen des Re-
vers, der hochgeschlossene Kragen, schwarz
abgeschlossene Taschen und Armbünde mit
rotemVorstoß undBlechknöpfe.
Wie bringt man in Zeiten von Globalisie-
rung und Individualisierung den nachfol-
genden Generationen die Tracht nahe?
Junge Leute finden heute meist über Fa-
schingsbräuche wie die Fasnacht oder das
Maschgern zur Tracht. Da wird anfangs das
Schlüpfen in eine andere Persönlichkeit als
spannend empfunden. Ab einem gewissen
Punkt geht es dann aber auch sehr um den
Ausdruck der Zugehörigkeit zu einer Grup-
pe. Und wenn sich die Jungen dann in der
Freizeit stolz mit einheitlichen Schildkap-
pen oder T-Shirts zeigen, auf denen „Brauch-
tumsvereinXY“ zu lesen ist, dann ist derWeg
zur Tracht nicht mehr ganz so weit. Wir ver-
suchen dann einfach mit sanfter Führung
die Richtung diesesWeges geradezuhalten.
Wie geht man dabei mit Einwanderern
und deren Kindern um?
Der Landestrachtenverband befürwortet die
Bildung vonKulturvereinen inEinwanderer-
kreisen.Alleinschondeshalb,weilwirauf der
Suche nach den ursprünglichen Ausformun-
gen unserer Sprache, Bräuche und Traditi-
onen auf Enklaven von Exiltirolern im Aus-
landstoßen–einBeispiel istdasDorfTirol im
Westen vonRumänien, das vonKriegsflücht-
lingen um1810 gegründet wurde. Umgekehrt
ist uns jeder Zuwanderer, der sich an unseren
Bräuchen und Traditionen beteiligen und
unsere Tracht tragen will, herzlich willkom-
men. Und das auch, wenn er einer anderen
Religionsgemeinschaft angehört.
Vielen Dank für das Gespräch.
„Unser G’wand“
Einer, der weiß, wovon er spricht, wenn es um das Thema Tracht geht, ist Reinhold Steiner,
Brauchtumsreferent des Bezirkstrachtenverbandes Innsbruck Stadt/Land und seit über
vierzig Jahren in verschiedensten Funktionen für den Landestrachtenverband tätig.
„Wer in Festtagstracht ins
Landestheater geht, ist
absolut passend gekleidet
und sticht sogar noch
positiv hervor.“
reinhold steiner, Brauchtumsreferent des Bezirkstrachten-
verbandes Innsbruck Stadt/Land
GroSSe Vielfalt
Rund achtzig verschiedene Trachten aus
Nord-Süd-undOsttirolwerdenimBand„Le-
bendige Tracht in Tirol“ von Gertrud Pesen-
dorfer dargestellt und beschrieben. In dieser
Vielfalt ist es nicht einfach, zusammenfas-
sende Eigenschaften ausfindig zu machen
– man kann aber eine grobe Einteilung nach
Talschaften vornehmen (siehe Infokasten).
Das genannte Buch gilt übrigens als Bibel der
Trachtenfreunde, die darin enthaltenen Ab-
bildungen repräsentieren die Muster, nach
denen aktuelle Trachten gefertigt werden.
Heute entdecken auch immer mehr
junge Menschen die Tracht für sich und
verhelfen dem kleidsamen Gewand so zu
frischer Lebendigkeit. Ein Indiz für diese
Entwicklung ist auch das volkskulturellen
Leistungsabzeichen (VLA, siehe Infokas-
ten), das 1988 vom Tiroler Landestrach-
tenverband eingeführt wurde und in den
Stufen Bronze, Silber und Gold abgelegt
werden kann. Etwa 2000 vorwiegend jün-
gere Menschen haben sich seither mindes-
tens einer der drei Prüfungen erfolgreich
unterzogen. Und das, obwohl das geforderte
praktische und theoretischeWissen enorm
ist. So gibt es tirolweit nur etwa 40 Perso-
nen, die die Prüfung zum VLA in Gold be-
standen haben.
Ganz allgemein befindet sich die origi-
näre Tracht im Aufwind – und zwar als Ge-
wand für Arbeit und Festlichkeiten, fernab
von jeglicherNostalgie undHeimattümlerei.
Als Trachtenträger im ursprünglichen Sinn
istmanganz einfachgut angezogenund setzt
noch dazu einen angenehmen Kontrapunkt
zum jeansgeprägtenAlltag.
7
Kinder der Landsturmgruppe Trachtenverein Westen-
dorf •
8
und
9
Trachten des Lechtales in verschiede-
nen Variationen
8
7
9
© tiroler trachtenverband (4)
46
47

