Basic HTML-Version



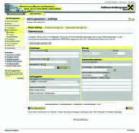

In achtzig Stunden um die Welt
Geld umkreist den Globus – und das nicht erst seit gestern. Die technischen Möglichkeiten
für Finanztransaktionen haben sich in den letzten 50 Jahren allerdings enorm verändert.
Text: Florian Pranger
E
in paar Klicks und die Überwei-
sung ist getätigt. Klar, dass sich
vor dem Internetzeitalter Trans-
aktionen deutlich aufwändiger
gestalteten. Allerdings ist es noch gar nicht
so lange her, dass Überweisungen für den
normalen Bankkunden überhaupt üblich
wurden. Als 1970 die Bankleitzahlen als
eindeutige Identifikationsmerkmale für
Geldinstitute eingeführt wurden, konnte
man erstmals per Zahlscheinabgabe am
Schalter Geldüberweisungen vornehmen.
Meist gab man den Überweisungsbetrag
noch in bar ab. Bei Überweisungen über
eine Tiroler Raiffeisenbank wurde der Be-
leg zuerst an die Raiffeisen Landesbank
übermittelt, wo die Verbuchung abgewi-
ckelt und der postalische Belegtransport
an die Empfängerbank – national wie auch
schon international – in Auftrag gegeben
wurde. Zwischen fünf und siebenWerktage
dauerte eine Inlandsüberweisung, ins Aus-
land war das Geld auch schon einmal bis zu
zwei Wochen unterwegs.
Auch das private Girokonto stand zu
Beginn der 70er Jahre erst am Anfang sei-
ner Verbreitung. Bis dahin erhielten Ar-
beiter und Angestellte in Österreich ihren
Lohn bzw. ihr Gehalt großteils in bar in
einfachen Papier- oder Jutetaschen, den
Lohntüten, ausbezahlt. Auf deren Außen-
seite waren Brutto- und Nettobetrag sowie
sämtliche Abgaben aufgelistet.
Einer, der die Zeit der enorm aufwän-
digen manuellen Überweisungen selbst
miterlebt hat, ist Herbert Eichhorn. Er lei-
tet heute die Raiffeisen Bankstelle Höttin-
ger Au in Innsbruck. „Als ich 1968 mit 18
Jahren am Schalter anfing, wurden noch
alle Privatüberweisungen in bar und über
Belege abgewickelt. Es gab damals zehn
größere Banken in Österreich, also wur-
den täglich alle Belege nach diesen Banken
geordnet und in zehn Stapeln an unsere
Zentrale übermittelt. Von dort kamen sie
in die jeweilige Zentrale der Empfänger-
bank, wo wiederum alle einlangenden
Belege sortiert und an die verschiedenen
Zielorte weitergeleitet wurden. Und wenn
am Abend Belege und verrechnete Beträge
nicht übereingestimmt haben, ist man erst
nachhause gegangen, wenn der Fehler ent-
deckt und behoben war.“ Dementsprechend
gab es auch andere Anforderungen an die
Bankangestellten. Herbert Eichhorn: „Wir
haben natürlich noch ohne Computer gear-
beitet. Unsere Rechenhilfe war die Curta,
eine kleine mechanische Rechenmaschine.
Es war sehr wichtig, gut kopfrechnen zu
können, um überschlagsmäßig die Ergeb-
nisse der Curta kontrollieren zu können.“
Magnetbänder und Belegleser
Zu ersten großen Veränderungen kam es
um 1980 mit der Einführung von Daten-
verarbeitungsgeräten im nationalen Zah-
lungsverkehr. Die Buchungen konnten von
diesenMaschinen auf Magnetbänder über-
spielt werden. Auch manche Großkunden
wie beispielsweise Versicherungsunter-
nehmen lieferten den Banken damals ihre
Daten auf Magnetbändern. Der aufwändige
Transport der einzelnen Belege von Kunde
zu Bank bzw. von Bank zu Bank wurde da-
mit stark reduziert. Privatüberweisungen
erfolgten aber immer noch ausnahmslos
über die Belegübermittlung per Post.
Um 1990 wurden in Großbanken und
Landeszentralen erstmals Belegleser in-
stalliert, die die händische Erfassung von
Buchungen überflüssig machten. Der große
Vorteil dieser Geräte war die Automatisie-
rung von Buchung und Archivierung. Die
Belege mussten allerdings nach wie vor von
den einzelnen Banken zur Zentrale und von
dort aus nach der Verarbeitung weiter zur
Empfängerbank transportiert werden.
Ein großer Entwicklungsschritt auf
dem Gebiet des Geldverkehres wurde
schließlich mit der Einführung der Scan-
Technologie getan, die bei den Tiroler
Raiffeisenbanken vor mittlerweile drei-
zehn Jahren erfolgte. Damit entfiel die
postalische Belegweiterleitung zur Gän-
ze, denn die Daten konnten zwischen den
Banken erstmals auf vollständig elektroni-
schemWege ausgetauscht werden.
Bewilligung von der Nationalbank
Internationale Überweisungen wurden
bis Ende der 1970er Jahre über spezielle
Formulare mit achtfacher Durchschrift
getätigt. Für die Raiffeisen-Bankengruppe
Tirol wurden sämtliche Auslandüberwei-
sungen zentral in der RLB Tirol AG bear-
beitet. Der Belegversand erfolgte wie im
Inland per Post bzw. mittels Fernschreiber,
um die Überweisungszeiten zu verkürzen.
„Es war schon ein sehr komplizierter Vor-
gang. Außerdem mussten Auslandszah-
lungen von Beträgen über 1000 Schilling
damals noch von der Österreichischen
Nationalbank bewilligt werden, was dazu
führte, dass es bis in die 80er Jahre kaum
Auslandsüberweisungen
gab“,
erinnert
sich Herbert Eichhorn.
1980 trat die Raiffeisen-Landesbank Ti-
rol AG der SWIFT (Society for Worldwide
Interbank Financial Telecommunication)
bei, einer 1973 gegründeten internationalen
Genossenschaft von Geldinstituten, die seit
1977 ein Telekommunikationsnetz für den
Nachrichtenaustausch zwischen ihren Mit-
gliedern betreibt. Damit wurden auch bei
internationalen Überweisungen die Formu-
larbefüllung per Schreibmaschine sowie die
postalische Belegweitergabe durch elektro-
nische Datenbearbeitung und Übertragung
ersetzt, was einen enormen Zeitgewinn zur
Folge hatte und Transaktionsraten wie die
aktuelle von Raiffeisen Tirol, nämlich etwa
200.000 pro Tag, erst möglichmachte.
EU-weite Regeln
In der EU wurde der internationale Geld-
verkehr, vor allemseit Einführung desEuro,
erheblich erleichtert und standardisiert. So
gilt seit Juli 2003 eine Verordnung wonach
Banken für grenzüberschreitende EU-
Überweisungen bis zu 50.000 Euro keine
höheren Gebühren als für Inlandsüberwei-
sungen einheben dürfen. Mit Anfang 2006
wurde das IBAN- und BIC-System einge-
führt, das die einheitliche Schreibweise
von Kontonummern und Bankcodes regelt,
damit auch international jedes Konto und
jede Bank eindeutig adressiert werden kön-
nen. Die Grenze zwischen nationalen und
europäischen Transaktionenwurde für den
Bankkunden im Jänner 2008 mit der Ein-
führung von SEPA (Single Euro Payments
Area), das auch alle Inlandsüberweisungen
standardisiert und gegenwärtig mehr als
500 Millionen Menschen umfasst, schließ-
lich gänzlich zum Verschwinden gebracht.
Die Überweisungsdauer wurde durch diese
strukturellen Neuerungen natürlich stark
reduziert. So braucht eine Inlands- bzw.
SEPA-Transaktion heute einen, in Ausnah-
mefällen zwei Werktage, im Nicht-SEPA-
Raum liegt die zeitliche Obergrenze bei drei
Arbeitstagen – inklusive Zeitverschiebung
also bei rund achtzig Stunden.
In technischer Hinsicht brachte das
Electronic Banking, kurz ELBA, die letzten
großenNeuerungen hinsichtlich bargeldlo-
ser Transaktionen in Österreich. 1989 als
ELBA-PC für Firmenkunden eingeführt,
wurde die Software stetigweiterentwickelt
und ist seit 1997 als ELBA Internet auch
für Privatkunden nutzbar. Damit können
Überweisungen ins In- und Ausland jeder-
zeit bargeld- und belegfrei durchgeführt
werden. Besonders im Firmenbereich wird
diese Überweisungsart immer mehr zum
Standard – und vorgedruckte Zahlschei-
ne und Belege erwartet der wohlverdiente
Platz imBankenmuseum.
Historisches
Geldüberweisen
Die bargeldlose Überweisung hat eine
lange Geschichte, reichen die histo-
rischen Spuren von ersten Konten,
Zahlungsanweisungen und wechsel-
ähnlichen Dokumenten doch zum Teil
mehr als dreitausend Jahre zurück.
Allerdings lässt sich über die ältesten
Überweisungssysteme kaum Allgemei-
nes berichten, waren sie doch örtlich
wie zeitlich begrenzt und dementspre-
chend vielfältig und zahlreich. Eine recht
bekannte und mancherorts immer noch
angewandte Methode des unbaren
Geldverkehres ist das um 1330 erstmals
erwähnte Hawala-System. Es stammt
aus dem arabischen Raum, beruht auf
persönlichem Vertrauen und ermöglicht
via Mittelsmänner rasche und kosten-
günstige Überweisungen über große Di-
stanzen. In der westlichen Welt, speziell
in Österreich, ist dieses Verfahren jedoch
ohne historische Bedeutung. Hier blieb
der Wechsel, also eine Urkunde, auf
deren Vorlage Geld ausbezahlt wurde,
lange die einzige mit heutigen Überwei-
sungen vergleichbare Form des unbaren
Geldverkehrs.
Mit wenigen Klicks zur Online-Überweisung:
Electronic Banking, kurz ELBA, gibt es für
Privatkunden seit 1997.
Die ersten beiden Raiffeisenbanken
Tirols wurden 1888 in Inzing (Bild) und
Oetz eröffnet.
Am Raiffeisen-Schalter vor dem
Computerzeitalter: Als Arbeitsgeräte
dienten Schreibmaschine und Curta, eine
mechanische Rechenmaschine.
„Auslandszahlungen von Beträgen
über 1000 Schillingmussten damals
noch von der ÖsterreichischenNatio
nalbank bewilligt werden, was dazu
führte, dass es bis in die 80er Jahre
kaumAuslandsüberweisungen gab.“
Herbert Eichhorn, leiter der rlb-bankstelle Höttinger au
© raiffeisen (4)
18
19

